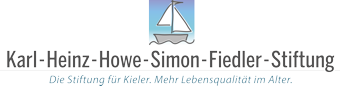Ageismus, was ist das überhaupt? Der Name wird hergeleitet vom englischen Wort "age" = Alter. Es geht um Benachteiligungen, Vorurteile, Diskriminierungen oder Ungerechtigkeiten, die sich gegen Menschen aufgrund ihres Alters richten. Dabei betrifft Ageismus alle Generationen, auch jüngere Menschen erfahren Diskriminierungen aufgrund ihrer Lebensjahre.
In diesem Blogbeitrag legen wir unseren Fokus auf die Menschen in ihrem dritten Lebensabschnitt und ihre altersbedingten Benachteiligungen im Alltäglichen.
Ageismus im Alltag
Ageismus beginnt im Kopf der Menschen und geht oft einher mit den Altersbildern, die in unserer Gesellschaft verbreitet sind (Siehe auch Blogbeitrag "Altersbilder"). Diese Vorurteile und die damit einhergehenden Diskriminierungen wirken sich auf das Leben vieler älterer Menschen negativ aus.
Neben alltäglichen Bemerkungen wie „der/die hat doch die besten Jahre schon hinter sich“ oder Verhaltensweisen wie die Nutzung einer besonders klaren und lauten Sprache mit der Annahme, dass ältere Menschen nicht so gut hören und verstehen können, gibt es verschiedene Lebensbereiche in die Altersdiskriminierung hineinspielt.
In der Arbeitswelt hören wir es immer wieder – ältere Arbeitnehmer*innen haben es schwer auf dem Arbeitsmarkt. Es kommt immer wieder zu Ungerechtigkeiten im Berufsleben oder auf der Jobsuche – ab einem bestimmten Lebensjahr sei man nicht mehr so leistungsfähig oder werde vergesslich.
Bei Finanzdienstleistungen werden ältere Menschen häufig durch altersbedingte Ausnahmeregelungen benachteiligt, insbesondere bei Krediten und Finanzierungen.
Auch im Gesundheitswesen haben betagtere Patient*innen mit Vorurteilen zu kämpfen. Wenn zum Beispiel aufgrund des Alters vermehrt von Krankheiten ausgegangen wird oder kognitive Einschränkungen angenommen werden, kann das zu einer weniger geeigneten Behandlung führen.
Fehlende altersgerechte Infrastrukturen oder eine unzureichende Barrierefreiheit führen immer wieder zu eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten und sozialen Begegnungen.
Beispiele sind Fotos in Zeitungsartikeln mit der Thematik Alter, auf denen beispielsweise reife Menschen mit Rollator und faltige & knöcherne Hände dargestellt werden, die die Sicht auf die belastende Finanzierung der Sicherungssysteme und der Pflege beinhalten.
Welche Folgen hat Ageismus?
Ageismus führt neben den alltäglichen Vorurteilen und Herausforderungen auch zu mentalen Unsicherheiten. Wie der 9. Altersbericht aufzeigt, hat eine diskriminierende Struktur negative Auswirkungen auf das Leben unserer betroffenen Mitbürger*innen. Denn unsere Gesellschaft orientiert sich „in ihrem Handeln und Verhalten mehr oder weniger an verbreitete Annahmen darüber, wie ältere Menschen sind oder was ältere Menschen normalerweise tun.“ (Neunter Altersbericht).
Dies führt dazu, dass sich ältere Menschen verstärkt zurückziehen und ein Gefühl der eigenen Bedeutungslosigkeit entsteht. Mögliche Potenziale der Generationen 60plus bleiben so ungenutzt.
Was können wir tun?
Wir als Gesellschaft sollten zunächst unser Bewusstsein für das Thema schärfen, Vorurteile überdenken und den „Wert“ von Senior*innen in unserem Umfeld schätzen lernen.
Denn ist es nicht so, dass die Jüngeren wunderbar von Lebenserfahrung und Fachwissen profitieren können? Und ist jemand mit 60 Jahren tatsächlich schon „alt“ oder nicht eher top fit und absolut leistungsfähig? Viele der sogenannten ALTEN werden ihren Beitrag zu den Sozialversicherungssystemen bis zum Reifegrad von 67 Jahren leisten.
Die gute Botschaft der Alternsforschung lautet: 70 ist tatsächlich das neue 55.
(Quelle: Altern – ältere Menschen – ein demographischer Wandel)
Die reifen Erwachsenen sind unverzichtbar im Bereich des bürgerlichen Engagements oder bei der Care Arbeit. Und letztlich hat eine Altersvielfalt in allen Bereichen nur Vorteile – sei es in der Wirtschaft, Stadtentwicklung oder Pflege.
Für mehr Miteinander und weniger Gegeneinander.